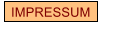© 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt
© 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt










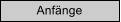

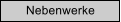
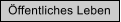

 In seinem „Abschiedsbrief“ vom 9. 3. 1945 an
Gerda Janota, die sich damals mit beider Sohn
in Linz aufhält, blickt Josef Weinheber kurz vor
seinem Tod und unter dem Eindruck der sich
gewaltig vollziehenden und bereits auf
niederösterreichischen Boden übergreifenden
Kriegskatastrophe auf sein Werk zurück und
erwägt noch einmal aus eigener Perspektive
dessen Bedeutung:
[...] Ich denke in diesen Tagen äußerster Not
viel nach über das Äußerste des Menschen und
schreibe das – in nicht ganz klassisch
gepflegten Epigrammen, muß ich sagen, nieder.
Du siehst wohl, wie fliehend ich schreibe – wie
ein Paralytiker im Anfangsstadium – das ist das
Ergebnis dieser Schreckenstage. Ich will Dir
aber das Herz nicht schwer machen. „Das
Abendland trug letzte Frucht – so schweige, wer
reden kann.“ [Zit. aus Schlußghasel in Hier ist
das Wort, SW II 633.] Aus Deinem Brief klingt
ein mutiger und entschlossener Ernst, und so
liebe ich Dich am meisten. Jeder sieht natürlich
in sich und seinen Kindern das Wichtigste der
Welt. Aber das Ich ist in Augenblicken solcher
entscheidenden Menschheitskrisen nicht mehr
gefragt. Es wirken Größen, oder besser, von
längerher wirksame Kräfte. Alles Zurückgestaute
dieses Kontinents will durchbrechen. Krankheiten
des Europäers, 2000 Jahre mitgeschleppt,
vertuscht wie eine Geschlechtskrankheit, (und an
was sonst als an Geschlechtskrankheiten geistiger
Art leiden wir Europäer!) stehen im Krisenzenit.
Spengler hat hier vorgewußt und auch
vorausgesagt. Auch ich: „hebt die
Vollstreckerhand und gibt das Zeichen. Was zu
lösen nimmer erlaubt, es zu tilgen, schlägt er mit
Nacht die Stirn - -“ [Zit. aus Zwischen Göttern
und Dämonen, Ode 1, SW II 407.] Ich habe
überhaupt, wenn ich in diesen entscheidenden
Tagen mein Werk – und ich kann kein anderes
mehr ohne es als Bagatelle zu empfinden,
ansehen – durchgehe, die Empfindung, daß hier
Dinge mit einer traumwandlerischen Klarheit
gesagt worden sind, wie nie vorher. Du kannst
das nachprüfen. Ich bitte Dich – Du erinnerst
mich im Kopf Deines Briefes an Michelagniolo –
die Sonette an die Nacht [in Späte Krone, SW II
315ff.] zu lesen. Du wirst sie jetzt anders lesen.
Das Gläserne ihrer Diktion (gleichbedeutend mit
erkennender Aussage), wird Dir jetzt erst zu
Bewußtsein kommen. Auch das Vor-Gedicht dazu:
Die Nacht ist groß: „Aufhalten kann ich nicht etc.“
[In Späte Krone, SW II 314.]
Als ich das alles schrieb, habe ich an dem, was
jetzt geschieht, gelitten. Jetzt bin ich gelähmt,
vom Leiden nicht mehr gesegnet. Denn: „Was
geschieht, lebt wilder denn das Geschaute. Wo ein
Herz schlägt, wird es gebrochen. Jede Welt
gebiert sich aus Morde.“ [Zit. aus Sache des
Sängers in Adel und Untergang, SW II 17] Wirst
Du mich, die mir so nahe ist und der ich so nahe
bin, endlich verstehen? Auch die unvermeidlichen
Brüche in einer solchen Selbstdarstellung des
Humanen, wie sie etwa dargestellt sind in dem
sprachlich eleganten, aber vollkommen der Zeit
dienenden „Hymnus auf die Heimkehr“ [s. SW III
411ff.]? Das alles mußte, weit weg von einer
geschlossenen inneren Form, gesagt,
herausgesagt werden, mit dem Gefühl, daß die
Zeit nicht mehr reichen würde, Kuppeln der
inneren Proportion zu bauen. Du bist einer der
wenigen Menschen, die es wissen, wissen
könnten, wie wenig Klassiker ich bin. Klassisch ist
meine äußere Form: Ein Schutzmittel, eine
1945: An Gerda Janota
weiter
In seinem „Abschiedsbrief“ vom 9. 3. 1945 an
Gerda Janota, die sich damals mit beider Sohn
in Linz aufhält, blickt Josef Weinheber kurz vor
seinem Tod und unter dem Eindruck der sich
gewaltig vollziehenden und bereits auf
niederösterreichischen Boden übergreifenden
Kriegskatastrophe auf sein Werk zurück und
erwägt noch einmal aus eigener Perspektive
dessen Bedeutung:
[...] Ich denke in diesen Tagen äußerster Not
viel nach über das Äußerste des Menschen und
schreibe das – in nicht ganz klassisch
gepflegten Epigrammen, muß ich sagen, nieder.
Du siehst wohl, wie fliehend ich schreibe – wie
ein Paralytiker im Anfangsstadium – das ist das
Ergebnis dieser Schreckenstage. Ich will Dir
aber das Herz nicht schwer machen. „Das
Abendland trug letzte Frucht – so schweige, wer
reden kann.“ [Zit. aus Schlußghasel in Hier ist
das Wort, SW II 633.] Aus Deinem Brief klingt
ein mutiger und entschlossener Ernst, und so
liebe ich Dich am meisten. Jeder sieht natürlich
in sich und seinen Kindern das Wichtigste der
Welt. Aber das Ich ist in Augenblicken solcher
entscheidenden Menschheitskrisen nicht mehr
gefragt. Es wirken Größen, oder besser, von
längerher wirksame Kräfte. Alles Zurückgestaute
dieses Kontinents will durchbrechen. Krankheiten
des Europäers, 2000 Jahre mitgeschleppt,
vertuscht wie eine Geschlechtskrankheit, (und an
was sonst als an Geschlechtskrankheiten geistiger
Art leiden wir Europäer!) stehen im Krisenzenit.
Spengler hat hier vorgewußt und auch
vorausgesagt. Auch ich: „hebt die
Vollstreckerhand und gibt das Zeichen. Was zu
lösen nimmer erlaubt, es zu tilgen, schlägt er mit
Nacht die Stirn - -“ [Zit. aus Zwischen Göttern
und Dämonen, Ode 1, SW II 407.] Ich habe
überhaupt, wenn ich in diesen entscheidenden
Tagen mein Werk – und ich kann kein anderes
mehr ohne es als Bagatelle zu empfinden,
ansehen – durchgehe, die Empfindung, daß hier
Dinge mit einer traumwandlerischen Klarheit
gesagt worden sind, wie nie vorher. Du kannst
das nachprüfen. Ich bitte Dich – Du erinnerst
mich im Kopf Deines Briefes an Michelagniolo –
die Sonette an die Nacht [in Späte Krone, SW II
315ff.] zu lesen. Du wirst sie jetzt anders lesen.
Das Gläserne ihrer Diktion (gleichbedeutend mit
erkennender Aussage), wird Dir jetzt erst zu
Bewußtsein kommen. Auch das Vor-Gedicht dazu:
Die Nacht ist groß: „Aufhalten kann ich nicht etc.“
[In Späte Krone, SW II 314.]
Als ich das alles schrieb, habe ich an dem, was
jetzt geschieht, gelitten. Jetzt bin ich gelähmt,
vom Leiden nicht mehr gesegnet. Denn: „Was
geschieht, lebt wilder denn das Geschaute. Wo ein
Herz schlägt, wird es gebrochen. Jede Welt
gebiert sich aus Morde.“ [Zit. aus Sache des
Sängers in Adel und Untergang, SW II 17] Wirst
Du mich, die mir so nahe ist und der ich so nahe
bin, endlich verstehen? Auch die unvermeidlichen
Brüche in einer solchen Selbstdarstellung des
Humanen, wie sie etwa dargestellt sind in dem
sprachlich eleganten, aber vollkommen der Zeit
dienenden „Hymnus auf die Heimkehr“ [s. SW III
411ff.]? Das alles mußte, weit weg von einer
geschlossenen inneren Form, gesagt,
herausgesagt werden, mit dem Gefühl, daß die
Zeit nicht mehr reichen würde, Kuppeln der
inneren Proportion zu bauen. Du bist einer der
wenigen Menschen, die es wissen, wissen
könnten, wie wenig Klassiker ich bin. Klassisch ist
meine äußere Form: Ein Schutzmittel, eine
1945: An Gerda Janota
weiter
 Anhang
Anhang
 Spätwerk
Spätwerk




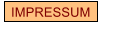





 © 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt
© 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt










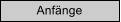

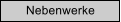
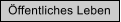

 In seinem „Abschiedsbrief“ vom 9. 3. 1945 an
Gerda Janota, die sich damals mit beider Sohn
in Linz aufhält, blickt Josef Weinheber kurz vor
seinem Tod und unter dem Eindruck der sich
gewaltig vollziehenden und bereits auf
niederösterreichischen Boden übergreifenden
Kriegskatastrophe auf sein Werk zurück und
erwägt noch einmal aus eigener Perspektive
dessen Bedeutung:
[...] Ich denke in diesen Tagen äußerster Not
viel nach über das Äußerste des Menschen und
schreibe das – in nicht ganz klassisch
gepflegten Epigrammen, muß ich sagen, nieder.
Du siehst wohl, wie fliehend ich schreibe – wie
ein Paralytiker im Anfangsstadium – das ist das
Ergebnis dieser Schreckenstage. Ich will Dir
aber das Herz nicht schwer machen. „Das
Abendland trug letzte Frucht – so schweige, wer
reden kann.“ [Zit. aus Schlußghasel in Hier ist
das Wort, SW II 633.] Aus Deinem Brief klingt
ein mutiger und entschlossener Ernst, und so
liebe ich Dich am meisten. Jeder sieht natürlich
in sich und seinen Kindern das Wichtigste der
Welt. Aber das Ich ist in Augenblicken solcher
entscheidenden Menschheitskrisen nicht mehr
gefragt. Es wirken Größen, oder besser, von
längerher wirksame Kräfte. Alles Zurückgestaute
dieses Kontinents will durchbrechen. Krankheiten
des Europäers, 2000 Jahre mitgeschleppt,
vertuscht wie eine Geschlechtskrankheit, (und an
was sonst als an Geschlechtskrankheiten geistiger
Art leiden wir Europäer!) stehen im Krisenzenit.
Spengler hat hier vorgewußt und auch
vorausgesagt. Auch ich: „hebt die
Vollstreckerhand und gibt das Zeichen. Was zu
lösen nimmer erlaubt, es zu tilgen, schlägt er mit
Nacht die Stirn - -“ [Zit. aus Zwischen Göttern
und Dämonen, Ode 1, SW II 407.] Ich habe
überhaupt, wenn ich in diesen entscheidenden
Tagen mein Werk – und ich kann kein anderes
mehr ohne es als Bagatelle zu empfinden,
ansehen – durchgehe, die Empfindung, daß hier
Dinge mit einer traumwandlerischen Klarheit
gesagt worden sind, wie nie vorher. Du kannst
das nachprüfen. Ich bitte Dich – Du erinnerst
mich im Kopf Deines Briefes an Michelagniolo –
die Sonette an die Nacht [in Späte Krone, SW II
315ff.] zu lesen. Du wirst sie jetzt anders lesen.
Das Gläserne ihrer Diktion (gleichbedeutend mit
erkennender Aussage), wird Dir jetzt erst zu
Bewußtsein kommen. Auch das Vor-Gedicht dazu:
Die Nacht ist groß: „Aufhalten kann ich nicht etc.“
[In Späte Krone, SW II 314.]
Als ich das alles schrieb, habe ich an dem, was
jetzt geschieht, gelitten. Jetzt bin ich gelähmt,
vom Leiden nicht mehr gesegnet. Denn: „Was
geschieht, lebt wilder denn das Geschaute. Wo ein
Herz schlägt, wird es gebrochen. Jede Welt
gebiert sich aus Morde.“ [Zit. aus Sache des
Sängers in Adel und Untergang, SW II 17] Wirst
Du mich, die mir so nahe ist und der ich so nahe
bin, endlich verstehen? Auch die unvermeidlichen
Brüche in einer solchen Selbstdarstellung des
Humanen, wie sie etwa dargestellt sind in dem
sprachlich eleganten, aber vollkommen der Zeit
dienenden „Hymnus auf die Heimkehr“ [s. SW III
411ff.]? Das alles mußte, weit weg von einer
geschlossenen inneren Form, gesagt,
herausgesagt werden, mit dem Gefühl, daß die
Zeit nicht mehr reichen würde, Kuppeln der
inneren Proportion zu bauen. Du bist einer der
wenigen Menschen, die es wissen, wissen
könnten, wie wenig Klassiker ich bin. Klassisch ist
meine äußere Form: Ein Schutzmittel, eine
1945: An Gerda Janota
weiter
In seinem „Abschiedsbrief“ vom 9. 3. 1945 an
Gerda Janota, die sich damals mit beider Sohn
in Linz aufhält, blickt Josef Weinheber kurz vor
seinem Tod und unter dem Eindruck der sich
gewaltig vollziehenden und bereits auf
niederösterreichischen Boden übergreifenden
Kriegskatastrophe auf sein Werk zurück und
erwägt noch einmal aus eigener Perspektive
dessen Bedeutung:
[...] Ich denke in diesen Tagen äußerster Not
viel nach über das Äußerste des Menschen und
schreibe das – in nicht ganz klassisch
gepflegten Epigrammen, muß ich sagen, nieder.
Du siehst wohl, wie fliehend ich schreibe – wie
ein Paralytiker im Anfangsstadium – das ist das
Ergebnis dieser Schreckenstage. Ich will Dir
aber das Herz nicht schwer machen. „Das
Abendland trug letzte Frucht – so schweige, wer
reden kann.“ [Zit. aus Schlußghasel in Hier ist
das Wort, SW II 633.] Aus Deinem Brief klingt
ein mutiger und entschlossener Ernst, und so
liebe ich Dich am meisten. Jeder sieht natürlich
in sich und seinen Kindern das Wichtigste der
Welt. Aber das Ich ist in Augenblicken solcher
entscheidenden Menschheitskrisen nicht mehr
gefragt. Es wirken Größen, oder besser, von
längerher wirksame Kräfte. Alles Zurückgestaute
dieses Kontinents will durchbrechen. Krankheiten
des Europäers, 2000 Jahre mitgeschleppt,
vertuscht wie eine Geschlechtskrankheit, (und an
was sonst als an Geschlechtskrankheiten geistiger
Art leiden wir Europäer!) stehen im Krisenzenit.
Spengler hat hier vorgewußt und auch
vorausgesagt. Auch ich: „hebt die
Vollstreckerhand und gibt das Zeichen. Was zu
lösen nimmer erlaubt, es zu tilgen, schlägt er mit
Nacht die Stirn - -“ [Zit. aus Zwischen Göttern
und Dämonen, Ode 1, SW II 407.] Ich habe
überhaupt, wenn ich in diesen entscheidenden
Tagen mein Werk – und ich kann kein anderes
mehr ohne es als Bagatelle zu empfinden,
ansehen – durchgehe, die Empfindung, daß hier
Dinge mit einer traumwandlerischen Klarheit
gesagt worden sind, wie nie vorher. Du kannst
das nachprüfen. Ich bitte Dich – Du erinnerst
mich im Kopf Deines Briefes an Michelagniolo –
die Sonette an die Nacht [in Späte Krone, SW II
315ff.] zu lesen. Du wirst sie jetzt anders lesen.
Das Gläserne ihrer Diktion (gleichbedeutend mit
erkennender Aussage), wird Dir jetzt erst zu
Bewußtsein kommen. Auch das Vor-Gedicht dazu:
Die Nacht ist groß: „Aufhalten kann ich nicht etc.“
[In Späte Krone, SW II 314.]
Als ich das alles schrieb, habe ich an dem, was
jetzt geschieht, gelitten. Jetzt bin ich gelähmt,
vom Leiden nicht mehr gesegnet. Denn: „Was
geschieht, lebt wilder denn das Geschaute. Wo ein
Herz schlägt, wird es gebrochen. Jede Welt
gebiert sich aus Morde.“ [Zit. aus Sache des
Sängers in Adel und Untergang, SW II 17] Wirst
Du mich, die mir so nahe ist und der ich so nahe
bin, endlich verstehen? Auch die unvermeidlichen
Brüche in einer solchen Selbstdarstellung des
Humanen, wie sie etwa dargestellt sind in dem
sprachlich eleganten, aber vollkommen der Zeit
dienenden „Hymnus auf die Heimkehr“ [s. SW III
411ff.]? Das alles mußte, weit weg von einer
geschlossenen inneren Form, gesagt,
herausgesagt werden, mit dem Gefühl, daß die
Zeit nicht mehr reichen würde, Kuppeln der
inneren Proportion zu bauen. Du bist einer der
wenigen Menschen, die es wissen, wissen
könnten, wie wenig Klassiker ich bin. Klassisch ist
meine äußere Form: Ein Schutzmittel, eine
1945: An Gerda Janota
weiter
 Anhang
Anhang
 Spätwerk
Spätwerk