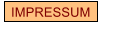© 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt
© 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt












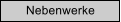
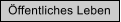

 Unterhaltungsroman). Der Künstler – deshalb
„Sprachkünstler“ genannt – müsse diesen
Grundverhältnissen aktiv, die Sprache „liebend“,
der Sprache „dienend“, gerecht werden, soll das
Kunstwerk nicht seines eigentlichen Wertes und
seiner Berechtigung verlustig gehen; keine
Ausflucht in die – vorsprachliche – „Inspiration“
sei hier erlaubt; nicht eine – außersprachliche –
„Realität“ diktiere das „Abbild“, das
Sprachkunstwerk selbst präge (zur)
Wirklichkeit. Kein sich aufdrängender Stoff,
keine weltanschauliche Aktualität vermöchten
als solche die Rolle dieser Gerichtetheit des
Kunstprozesses auf sprachlich-formale
Gestaltqualitäten (und auf Metaphorizität) zu
übernehmen: Sie enthöben den bildenden und
bauenden Künstler nicht der sprachlichen
Bedeutungs- bzw. Verdichtungsarbeit – das
Werk in seinem Sein, d. h. phänomenal, sei
nicht außerhalb dieses sprachgetragenen
Bedeutungsgefüges denk- und verfügbar –, und
den Wahrnehmenden verpflichte das
„sprachkünstlerische“ Gedicht folgerichtig
gleichfalls zu höchster personaler Aktivität, zu
„nachgestaltendem“ Lesen, wie es Weinheber
daher für sein Werk einfordert [3]. An dieser
Stelle setzt erst die Neuleistung an, die
Weinheber für seine Lyrik (niemals für seine
restlichen Schriften!) beansprucht und, 1942, als
schrittweise erzieltes Ergebnis einer mehr als ein
Vierteljahrhundert umfassenden experimentalen
Suche nach dem Gedicht kennzeichnet [4].
Gegenüber dem in Bristol wirkenden Germanisten
August Closs, der in den Jahren 1936/1937 eine
Würdigung Weinhebers erstellt, die in
zeittypischer Weise die weltanschauliche
Persönlichkeit „hinter der Dichtung“ zum
Gegenstand macht und dabei die Gestaltkriterien,
mithin das Gegenständliche der Dichtung selbst,
nahezu völlig vernachlässigt, verweist Weinheber,
die von der Kritik lange ausständige
„philologische“ Arbeit einmahnend, auf die
Unmöglichkeit, solcherart überhaupt zu jener
originalen Qualität seiner Lyrik vorzudringen: Die
liege „ja gerade darin“, daß er „früher
übersehene[] oder nur dumpf als Möglichkeiten
zur Einleibung empfundene[] Werte bewußt in die
Gestaltung einbeziehe“; sie nicht zu beachten, der
Mangel an Aufmerksamkeit für diese
„Möglichkeiten“ führe also unweigerlich zu einem
gravierenden Verständnisproblem, zu
Banalisierung, Nivellierung [5]. Die Wege der
„Einleibung“, d. h. der Integration spezifischer
sinnlich-formaler Elemente als neuwertiger
Zeichenwelten in den Gefügeprozeß, in dem die
Gedichtsprache mit Bedeutung erfüllt wird, wollen
im wesentlichen in zwei großen, teilweise auch
entwicklungsgeschichtlich trennbaren Bereichen
gesucht werden; sie können hier bestenfalls
angedeutet werden: Der erste Bereich umfaßt die
Konstitution der „Wortgestalt“ und hier
insbesondere die Möglichkeiten der
„lautsymbolischen“ oder „lautplastischen“
Verdichtung. Selbstverständlich gilt bereits hier
alle Aufmerksamkeit des Dichters (und des
Lesers) dem „Wort- und Begriffsgewebe“ (ein
zentraler Terminus Leopold Lieglers aus dessen
von Weinheber intensiv studierter Karl Kraus-
Monographie), das durch vielschichtig leitende
Beziehungen – Antithesen, Parallelismen,
Spannungen usw. – den geordneten
Zeichencharakter des Kunstwerks herstellt und
dem jene phonetischen und morphematischen
Strukturen zuarbeiten. Das Wort an sich hat, als
Vokabel, nichts, was Bedeutung zu nennen wäre,
es erlangt diese erst durch sprachliche
Kontextualisierung, d. h. durch den literarischen
Textprozeß: Die Bedeutung wird ihm, so sorgfältig
und umsichtig wie möglich, im Gedicht verliehen.
Jeder Fehler, jede Nachlässigkeit auf diesem
Gebiet wird – unzählige Male Gegenstand der
Fackel-Satire – in der Sprache selbst unweigerlich
sichtbar und stellt, über das „signandum“, den
Sprecher und das Gesagte, das „signatum“, bloß.
zurück
weiter
Unterhaltungsroman). Der Künstler – deshalb
„Sprachkünstler“ genannt – müsse diesen
Grundverhältnissen aktiv, die Sprache „liebend“,
der Sprache „dienend“, gerecht werden, soll das
Kunstwerk nicht seines eigentlichen Wertes und
seiner Berechtigung verlustig gehen; keine
Ausflucht in die – vorsprachliche – „Inspiration“
sei hier erlaubt; nicht eine – außersprachliche –
„Realität“ diktiere das „Abbild“, das
Sprachkunstwerk selbst präge (zur)
Wirklichkeit. Kein sich aufdrängender Stoff,
keine weltanschauliche Aktualität vermöchten
als solche die Rolle dieser Gerichtetheit des
Kunstprozesses auf sprachlich-formale
Gestaltqualitäten (und auf Metaphorizität) zu
übernehmen: Sie enthöben den bildenden und
bauenden Künstler nicht der sprachlichen
Bedeutungs- bzw. Verdichtungsarbeit – das
Werk in seinem Sein, d. h. phänomenal, sei
nicht außerhalb dieses sprachgetragenen
Bedeutungsgefüges denk- und verfügbar –, und
den Wahrnehmenden verpflichte das
„sprachkünstlerische“ Gedicht folgerichtig
gleichfalls zu höchster personaler Aktivität, zu
„nachgestaltendem“ Lesen, wie es Weinheber
daher für sein Werk einfordert [3]. An dieser
Stelle setzt erst die Neuleistung an, die
Weinheber für seine Lyrik (niemals für seine
restlichen Schriften!) beansprucht und, 1942, als
schrittweise erzieltes Ergebnis einer mehr als ein
Vierteljahrhundert umfassenden experimentalen
Suche nach dem Gedicht kennzeichnet [4].
Gegenüber dem in Bristol wirkenden Germanisten
August Closs, der in den Jahren 1936/1937 eine
Würdigung Weinhebers erstellt, die in
zeittypischer Weise die weltanschauliche
Persönlichkeit „hinter der Dichtung“ zum
Gegenstand macht und dabei die Gestaltkriterien,
mithin das Gegenständliche der Dichtung selbst,
nahezu völlig vernachlässigt, verweist Weinheber,
die von der Kritik lange ausständige
„philologische“ Arbeit einmahnend, auf die
Unmöglichkeit, solcherart überhaupt zu jener
originalen Qualität seiner Lyrik vorzudringen: Die
liege „ja gerade darin“, daß er „früher
übersehene[] oder nur dumpf als Möglichkeiten
zur Einleibung empfundene[] Werte bewußt in die
Gestaltung einbeziehe“; sie nicht zu beachten, der
Mangel an Aufmerksamkeit für diese
„Möglichkeiten“ führe also unweigerlich zu einem
gravierenden Verständnisproblem, zu
Banalisierung, Nivellierung [5]. Die Wege der
„Einleibung“, d. h. der Integration spezifischer
sinnlich-formaler Elemente als neuwertiger
Zeichenwelten in den Gefügeprozeß, in dem die
Gedichtsprache mit Bedeutung erfüllt wird, wollen
im wesentlichen in zwei großen, teilweise auch
entwicklungsgeschichtlich trennbaren Bereichen
gesucht werden; sie können hier bestenfalls
angedeutet werden: Der erste Bereich umfaßt die
Konstitution der „Wortgestalt“ und hier
insbesondere die Möglichkeiten der
„lautsymbolischen“ oder „lautplastischen“
Verdichtung. Selbstverständlich gilt bereits hier
alle Aufmerksamkeit des Dichters (und des
Lesers) dem „Wort- und Begriffsgewebe“ (ein
zentraler Terminus Leopold Lieglers aus dessen
von Weinheber intensiv studierter Karl Kraus-
Monographie), das durch vielschichtig leitende
Beziehungen – Antithesen, Parallelismen,
Spannungen usw. – den geordneten
Zeichencharakter des Kunstwerks herstellt und
dem jene phonetischen und morphematischen
Strukturen zuarbeiten. Das Wort an sich hat, als
Vokabel, nichts, was Bedeutung zu nennen wäre,
es erlangt diese erst durch sprachliche
Kontextualisierung, d. h. durch den literarischen
Textprozeß: Die Bedeutung wird ihm, so sorgfältig
und umsichtig wie möglich, im Gedicht verliehen.
Jeder Fehler, jede Nachlässigkeit auf diesem
Gebiet wird – unzählige Male Gegenstand der
Fackel-Satire – in der Sprache selbst unweigerlich
sichtbar und stellt, über das „signandum“, den
Sprecher und das Gesagte, das „signatum“, bloß.
zurück
weiter
 Anhang
Anhang

 Spätwerk
Spätwerk





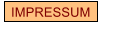
(3) Siehe den Brief an Martin Sturm
vom 3. 3. 1945, WN V 560, vgl. SW IV
67, 121f., 134, 570, 614, V 395 etc.
(4) Rückblick und Rechtfertigung,
1942, SW IV 178.
(5) Brief an August Closs vom 1. 7.
1937, WN V 419.





 © 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt
© 2019 Josef Weinheber-Gesellschaft Die gesamten Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt












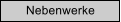
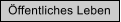

 Unterhaltungsroman). Der Künstler – deshalb
„Sprachkünstler“ genannt – müsse diesen
Grundverhältnissen aktiv, die Sprache „liebend“,
der Sprache „dienend“, gerecht werden, soll das
Kunstwerk nicht seines eigentlichen Wertes und
seiner Berechtigung verlustig gehen; keine
Ausflucht in die – vorsprachliche – „Inspiration“
sei hier erlaubt; nicht eine – außersprachliche –
„Realität“ diktiere das „Abbild“, das
Sprachkunstwerk selbst präge (zur)
Wirklichkeit. Kein sich aufdrängender Stoff,
keine weltanschauliche Aktualität vermöchten
als solche die Rolle dieser Gerichtetheit des
Kunstprozesses auf sprachlich-formale
Gestaltqualitäten (und auf Metaphorizität) zu
übernehmen: Sie enthöben den bildenden und
bauenden Künstler nicht der sprachlichen
Bedeutungs- bzw. Verdichtungsarbeit – das
Werk in seinem Sein, d. h. phänomenal, sei
nicht außerhalb dieses sprachgetragenen
Bedeutungsgefüges denk- und verfügbar –, und
den Wahrnehmenden verpflichte das
„sprachkünstlerische“ Gedicht folgerichtig
gleichfalls zu höchster personaler Aktivität, zu
„nachgestaltendem“ Lesen, wie es Weinheber
daher für sein Werk einfordert [3]. An dieser
Stelle setzt erst die Neuleistung an, die
Weinheber für seine Lyrik (niemals für seine
restlichen Schriften!) beansprucht und, 1942, als
schrittweise erzieltes Ergebnis einer mehr als ein
Vierteljahrhundert umfassenden experimentalen
Suche nach dem Gedicht kennzeichnet [4].
Gegenüber dem in Bristol wirkenden Germanisten
August Closs, der in den Jahren 1936/1937 eine
Würdigung Weinhebers erstellt, die in
zeittypischer Weise die weltanschauliche
Persönlichkeit „hinter der Dichtung“ zum
Gegenstand macht und dabei die Gestaltkriterien,
mithin das Gegenständliche der Dichtung selbst,
nahezu völlig vernachlässigt, verweist Weinheber,
die von der Kritik lange ausständige
„philologische“ Arbeit einmahnend, auf die
Unmöglichkeit, solcherart überhaupt zu jener
originalen Qualität seiner Lyrik vorzudringen: Die
liege „ja gerade darin“, daß er „früher
übersehene[] oder nur dumpf als Möglichkeiten
zur Einleibung empfundene[] Werte bewußt in die
Gestaltung einbeziehe“; sie nicht zu beachten, der
Mangel an Aufmerksamkeit für diese
„Möglichkeiten“ führe also unweigerlich zu einem
gravierenden Verständnisproblem, zu
Banalisierung, Nivellierung [5]. Die Wege der
„Einleibung“, d. h. der Integration spezifischer
sinnlich-formaler Elemente als neuwertiger
Zeichenwelten in den Gefügeprozeß, in dem die
Gedichtsprache mit Bedeutung erfüllt wird, wollen
im wesentlichen in zwei großen, teilweise auch
entwicklungsgeschichtlich trennbaren Bereichen
gesucht werden; sie können hier bestenfalls
angedeutet werden: Der erste Bereich umfaßt die
Konstitution der „Wortgestalt“ und hier
insbesondere die Möglichkeiten der
„lautsymbolischen“ oder „lautplastischen“
Verdichtung. Selbstverständlich gilt bereits hier
alle Aufmerksamkeit des Dichters (und des
Lesers) dem „Wort- und Begriffsgewebe“ (ein
zentraler Terminus Leopold Lieglers aus dessen
von Weinheber intensiv studierter Karl Kraus-
Monographie), das durch vielschichtig leitende
Beziehungen – Antithesen, Parallelismen,
Spannungen usw. – den geordneten
Zeichencharakter des Kunstwerks herstellt und
dem jene phonetischen und morphematischen
Strukturen zuarbeiten. Das Wort an sich hat, als
Vokabel, nichts, was Bedeutung zu nennen wäre,
es erlangt diese erst durch sprachliche
Kontextualisierung, d. h. durch den literarischen
Textprozeß: Die Bedeutung wird ihm, so sorgfältig
und umsichtig wie möglich, im Gedicht verliehen.
Jeder Fehler, jede Nachlässigkeit auf diesem
Gebiet wird – unzählige Male Gegenstand der
Fackel-Satire – in der Sprache selbst unweigerlich
sichtbar und stellt, über das „signandum“, den
Sprecher und das Gesagte, das „signatum“, bloß.
zurück
weiter
Unterhaltungsroman). Der Künstler – deshalb
„Sprachkünstler“ genannt – müsse diesen
Grundverhältnissen aktiv, die Sprache „liebend“,
der Sprache „dienend“, gerecht werden, soll das
Kunstwerk nicht seines eigentlichen Wertes und
seiner Berechtigung verlustig gehen; keine
Ausflucht in die – vorsprachliche – „Inspiration“
sei hier erlaubt; nicht eine – außersprachliche –
„Realität“ diktiere das „Abbild“, das
Sprachkunstwerk selbst präge (zur)
Wirklichkeit. Kein sich aufdrängender Stoff,
keine weltanschauliche Aktualität vermöchten
als solche die Rolle dieser Gerichtetheit des
Kunstprozesses auf sprachlich-formale
Gestaltqualitäten (und auf Metaphorizität) zu
übernehmen: Sie enthöben den bildenden und
bauenden Künstler nicht der sprachlichen
Bedeutungs- bzw. Verdichtungsarbeit – das
Werk in seinem Sein, d. h. phänomenal, sei
nicht außerhalb dieses sprachgetragenen
Bedeutungsgefüges denk- und verfügbar –, und
den Wahrnehmenden verpflichte das
„sprachkünstlerische“ Gedicht folgerichtig
gleichfalls zu höchster personaler Aktivität, zu
„nachgestaltendem“ Lesen, wie es Weinheber
daher für sein Werk einfordert [3]. An dieser
Stelle setzt erst die Neuleistung an, die
Weinheber für seine Lyrik (niemals für seine
restlichen Schriften!) beansprucht und, 1942, als
schrittweise erzieltes Ergebnis einer mehr als ein
Vierteljahrhundert umfassenden experimentalen
Suche nach dem Gedicht kennzeichnet [4].
Gegenüber dem in Bristol wirkenden Germanisten
August Closs, der in den Jahren 1936/1937 eine
Würdigung Weinhebers erstellt, die in
zeittypischer Weise die weltanschauliche
Persönlichkeit „hinter der Dichtung“ zum
Gegenstand macht und dabei die Gestaltkriterien,
mithin das Gegenständliche der Dichtung selbst,
nahezu völlig vernachlässigt, verweist Weinheber,
die von der Kritik lange ausständige
„philologische“ Arbeit einmahnend, auf die
Unmöglichkeit, solcherart überhaupt zu jener
originalen Qualität seiner Lyrik vorzudringen: Die
liege „ja gerade darin“, daß er „früher
übersehene[] oder nur dumpf als Möglichkeiten
zur Einleibung empfundene[] Werte bewußt in die
Gestaltung einbeziehe“; sie nicht zu beachten, der
Mangel an Aufmerksamkeit für diese
„Möglichkeiten“ führe also unweigerlich zu einem
gravierenden Verständnisproblem, zu
Banalisierung, Nivellierung [5]. Die Wege der
„Einleibung“, d. h. der Integration spezifischer
sinnlich-formaler Elemente als neuwertiger
Zeichenwelten in den Gefügeprozeß, in dem die
Gedichtsprache mit Bedeutung erfüllt wird, wollen
im wesentlichen in zwei großen, teilweise auch
entwicklungsgeschichtlich trennbaren Bereichen
gesucht werden; sie können hier bestenfalls
angedeutet werden: Der erste Bereich umfaßt die
Konstitution der „Wortgestalt“ und hier
insbesondere die Möglichkeiten der
„lautsymbolischen“ oder „lautplastischen“
Verdichtung. Selbstverständlich gilt bereits hier
alle Aufmerksamkeit des Dichters (und des
Lesers) dem „Wort- und Begriffsgewebe“ (ein
zentraler Terminus Leopold Lieglers aus dessen
von Weinheber intensiv studierter Karl Kraus-
Monographie), das durch vielschichtig leitende
Beziehungen – Antithesen, Parallelismen,
Spannungen usw. – den geordneten
Zeichencharakter des Kunstwerks herstellt und
dem jene phonetischen und morphematischen
Strukturen zuarbeiten. Das Wort an sich hat, als
Vokabel, nichts, was Bedeutung zu nennen wäre,
es erlangt diese erst durch sprachliche
Kontextualisierung, d. h. durch den literarischen
Textprozeß: Die Bedeutung wird ihm, so sorgfältig
und umsichtig wie möglich, im Gedicht verliehen.
Jeder Fehler, jede Nachlässigkeit auf diesem
Gebiet wird – unzählige Male Gegenstand der
Fackel-Satire – in der Sprache selbst unweigerlich
sichtbar und stellt, über das „signandum“, den
Sprecher und das Gesagte, das „signatum“, bloß.
zurück
weiter
 Anhang
Anhang

 Spätwerk
Spätwerk